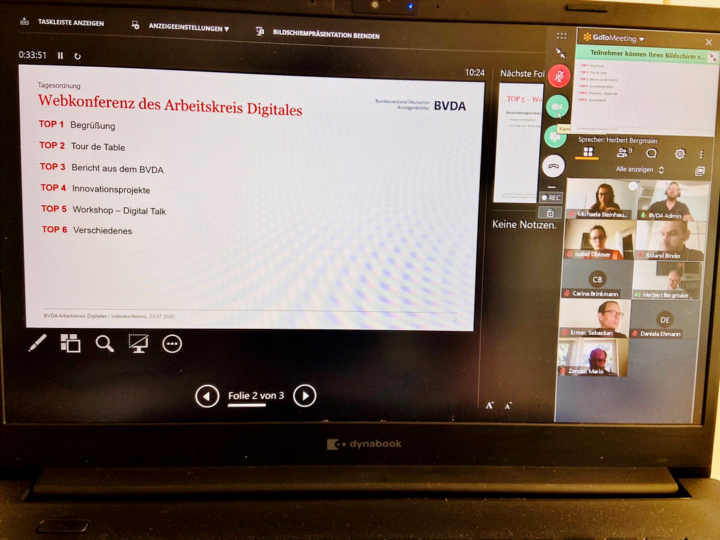Innovationsförderung für Verlage
Innovation ist ein unabdingbarer Motor für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Vieles, was gestern noch Zukunftsvision war, gehört heute zum Alltag und kann morgen schon überholt sein. Von der Idee bis zur Umsetzung durchlaufen Innovationen eine Vielzahl von Stadien und wirken sich letztlich auf das gesamte Unternehmen aus. So vielfältig wie die Innovationsprojekte selbst, ist auch die vorhandene Förderlandschaft auf EU-, Bundes- und Landesebene.
Der BVDA hat die Bedeutung von Innovation und technologischem Fortschritt erkannt. Mit der „Zukunftsarena Anzeigenblatt“ hat der Verband bereits einen ersten Meilenstein im Bereich Geschäftsmodellentwicklung gesetzt. Als kommunikative Plattform der Branche und in seiner Rolle als Berater unterstützt der Verband die Verlage bei allen auftauchenden Fragen.
Innovationskultur – Holen Sie Ihr Team ab.
„Culture Eats Strategy For Breakfast“ – dieser oft zitierte Satz drückt aus, dass vielversprechende Pläne in einem Unternehmen nur gelingen können, wenn sie sich in der Unternehmenskultur wiederfinden. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung von Ideen und die Ermöglichung von Innovationen. Hier kann eine innovationsorientierte Kultur wertvolle Unterstützung bieten. Sollen zukunftsweisende Vorhaben gelingen, müssen diese nicht nur von der Leitungsebene, sondern von der gesamten Belegschaft getragen und gelebt werden.
Neue Geschäftsmodelle – Zukünftige Märkte verstehen und erschließen
In der „Zukunftsarena Anzeigenblatt“ haben die BVDA-Mitgliedsverlage die Möglichkeit erhalten, Geschäftsmodellideen unter professioneller Anleitung mit dem „Business Model Canvas“ strukturiert aufzuarbeiten. Das Modell bietet einen übersichtlichen Analyserahmen um Angebote und Nachfragepotenziale im Hinblick auf die Marktsituation unternehmerisch zu bewerten. Für die Ideenfindung und -bewertung wurden zudem gesellschaftliche Megatrends und Sinus-Milieus beachtet sowie typische „Personas“ gebildet, die einzelne Segmente der Leserschaft veranschaulichen und abbilden.
Im Fokus eines neuen Geschäftsmodells stehen demnach die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, die mit einem neuen Produkt angesprochen werden. Weitere Anregungen zu diesem Thema finden sich auch in einer User Research, die das Media Lab Bayern durchgeführt hat. Die Untersuchung gibt Hinweis darauf, wo Verlage im Hinblick auf redaktionelle Strategie und Produktentwicklung ansetzen können, um den verschiedenen Nutzertypen der kostenlosen Wochenzeitungen gerecht zu werden und neue Leserinnen und Leser zu gewinnen.
Innovation im Mittelstand – Vielfältige Möglichkeiten
Die Bundesregierung unterstützt die Durchführung von Forschungs- und Innovationsprojekten im Rahmen von themenspezifischen und themenoffenen Förderprogrammen. Eine Vielzahl an Förderprogrammen richtet sich an „kleine und mittlere Unternehmen“ (KMU). Einen guten Überblick bieten die BMWK-Broschüre „Von der Idee zum Markterfolg“ sowie der Wegweiser „Forschungs- und Innovationsförderung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Ein Großteil dieser Förderprojekte lehnt sich bei der Definition förderberechtigter KMU in der einen oder anderen Art und Weise an die Empfehlung der EU-Kommission zur Einstufung von KMU an. Neben der Beschäftigtenzahl (<250, als Vollzeitäquivalente), dem Umsatz (max. 50 Mio. Euro) und der Bilanzsumme (max. 43 Mio. Euro) spielt dabei auch die Unternehmensstruktur eine Rolle. Insbesondere KMU, die Teil einer größeren Unternehmensstruktur sind, können sich anders als echte KMU auf eine stärkere wirtschaftliche Position stützen und sollen nach dem Willen der Kommission nicht von Unterstützungsmaßnahmen für KMU profitieren.
Im Verlagswesen fällt die genaue schematische Bestimmung eines KMU in Bezug auf Gruppenstrukturen und angegliederte Zustellgesellschaften oftmals schwer. Da die KMU-Definition innerhalb der einzelnen Förderprogramme teilweise unterschiedlich ausgelegt und angewendet wird, ist eine Einzelfallprüfung auf Basis der jeweiligen Förderrichtlinie unerlässlich, um zu beurteilen, ob eine Förderung für Ihren Verlag/Ihr Unternehmen in Frage kommt. Für eine Einschätzung Ihres Unternehmens als KMU kann das Merkblatt der KfW-Förderbank eine erste Orientierung bieten.
Mittelstand-Digital: Nutzen Sie kostenlose Unterstützungsangebote.
 Mit der Initiative Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen. In bundesweit 26 regionalen und thematischen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren erhalten interessierte Unternehmen kostenlos Zugang zu Informationen und Schulungsangeboten im Bereich Digitalisierung sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Die Angebote eignen sich sowohl für Unternehmen, die gerade erst mit der Digitalisierung beginnen, als auch weiter fortgeschrittene Betriebe.
Mit der Initiative Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen. In bundesweit 26 regionalen und thematischen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren erhalten interessierte Unternehmen kostenlos Zugang zu Informationen und Schulungsangeboten im Bereich Digitalisierung sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Die Angebote eignen sich sowohl für Unternehmen, die gerade erst mit der Digitalisierung beginnen, als auch weiter fortgeschrittene Betriebe.
Das Mittelstand-Digital Zentrum Berlin stellt sich vor:
 Das Mittelstand-Digital-Zentrum Berlin ist die branchenübergreifende Anlaufstelle für kleine und mittlere Unternehmen in Berlin, Brandenburg und bundesweit. Von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung und Erfolgsmessung gibt es Antworten auf Fragen der Digitalisierung aus der unternehmerischen Praxis. Mit Veranstaltungen, Workshops, Digitalisierungsangeboten, Unternehmenssprechstunden, Infomaterialien, Checklisten und vielem mehr werden Antworten auf Fragen der Digitalisierung aus der unternehmerischen Praxis geboten. Die Angebote decken die Themen Geschäftsmodelle, digitales Marketing, IT-Sicherheit, Wertschöpfungsprozesse, Personal, Weiterbildung, FinTech und Künstliche Intelligenz ab.
Das Mittelstand-Digital-Zentrum Berlin ist die branchenübergreifende Anlaufstelle für kleine und mittlere Unternehmen in Berlin, Brandenburg und bundesweit. Von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung und Erfolgsmessung gibt es Antworten auf Fragen der Digitalisierung aus der unternehmerischen Praxis. Mit Veranstaltungen, Workshops, Digitalisierungsangeboten, Unternehmenssprechstunden, Infomaterialien, Checklisten und vielem mehr werden Antworten auf Fragen der Digitalisierung aus der unternehmerischen Praxis geboten. Die Angebote decken die Themen Geschäftsmodelle, digitales Marketing, IT-Sicherheit, Wertschöpfungsprozesse, Personal, Weiterbildung, FinTech und Künstliche Intelligenz ab.
Innovationsbündnisse – Erkundigen Sie sich nach möglichen Partnern in Ihrer Region.
Insbesondere für solche Verlage, die noch keine Erfahrung mit Innovationsförderung haben, kann es von Vorteil sein, sich „Verbündete“ zu suchen. Innovationen und damit neue unternehmerische Chancen und wirtschaftliche Dynamik entstehen vor allem dort, wo sich Disziplinen, Branchen sowie Akteurinnen und Akteure begegnen – und wo Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten kreativ zusammenarbeiten. Engagierte Partner können sich aus unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Verwaltung, Verbandswesen und Politik rekrutieren lassen. Die Kombination der jeweiligen Kernkompetenzen kann eine strategische Allianz zum Erfolg führen.
Think Big – Innovationsförderung für große Unternehmen und Konzerne
Auch große Unternehmen und Konzerne haben Chancen auf eine staatliche Förderung, wenn sie in Innovationen investieren. Im Vordergrund der Bundesprogramme steht dabei vor allem der Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft. Eine gute Möglichkeit bieten demnach Verbundprojekte in Kooperation mit Forschungseinrichtungen oder Hochschulen. Zudem kommen bestimmte Förderprogramme für Investitionen und Betriebsmittel in Betracht. Auch die Fördermöglichkeiten im Rahmen des Forschungszulagengesetzes (FZulG), das am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, können von größeren Unternehmen und Konzernen in Anspruch genommen werden. Auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums (BMF) finden sich dazu weitere Informationen sowie ein FAQ.
Beispielhafte Förderprogramme im Steckbriefformat
Die hier dargestellten Steckbriefe stellen nur eine kleine Auswahl an Förderprogrammen aus dem vielfältigen Angebot der Förderlandschaft dar.
Wer kann gefördert werden?
- Kleine und mittlere Unternehmen.
- Mittelständische Unternehmen, wenn sie einschließlich verbundener oder Partnerunternehmen bei Antragstellung weniger als 1.000 Beschäftigte haben, wobei ab 500 Beschäftigten eine Antragsberechtigung nur gegeben ist, sofern das Unternehmen mit einem KMU kooperiert.
- Öffentliche und private, nicht wirtschaftlich tätige deutsche Forschungseinrichtungen, wenn sie Kooperationspartner eines geförderten Unternehmens sind.
Förderschwerpunkt:
- Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen sowie Leistungen zur Markteinführung.
- Anwendungsnahes Wissens durch Wissens- und Technologietransfer in Innovationsnetzwerken.
Was wird gefördert?
- Einzelbetriebliche FuE-Projekte .
- FuE-Kooperationsprojekte von Unternehmen oder Unternehmen und Forschungseinrichtungen.
- Management- und Organisationsdienstleistungen für innovative Netzwerke.
- z. T. Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von FuE-Aktivitäten in Form eines geplanten ZIM-FuE-Projekts.
Maximale Förderhöhe:
- 550.000 Euro für Einzelprojekte.
- 450.000 Euro pro Unternehmen sowie 220.000 Euro für kooperierende Forschungseinrichtungen in Kooperationsprojekten.
- 420.000 Euro für nationale sowie 520.000 Euro für internationale Innovationsprojekte.
- 100.000 Euro pro Unternehmen für Durchführbarkeitsstudien.
Antragstellung:
- Antragstellung vor Projektbeginn und vor dem Abschluss von Verträgen zwischen den beteiligten Projektpartnern.
- Formulargebundene Antragstellung beim zuständigen Projektträger.
- Antragstellung ist fortlaufend möglich.
Art der Zuwendung:
- Nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung.
- De-minimis: Teilweise, vor allem in Bezug auf begleitende Maßnahmen. Für die Förderung direkter FuE-Leistungen kommt die De-Minimis-Regelung nicht zur Anwendung.
Wer kann gefördert werden?
- Kleine und mittlere Unternehmen.
- Kooperierende, nicht wirtschaftlich tätige deutsche Forschungseinrichtungen und Hochschulen.
- Öffentliche und private, nicht wirtschaftlich tätige deutsche Forschungseinrichtungen, wenn sie Kooperationspartner eines geförderten Unternehmens sind.
Förderschwerpunkt:
- Förderung nichttechnischer Innovationen.
Was wird gefördert?
- Machbarkeitstests (höchstens 12 Monate).
- Ausreifung und Pilotierung von Geschäftsmodellen (höchstens 24 Monate).
- Innovationsnetzwerke im Auftrag von mindestens fünf voneinander unabhängigen und im IGP antragsberechtigten Unternehmen (höchstens 27 Monate).
Maximale Förderhöhe:
- 70 % der zuwendungsfähigen Kosten von max. 70.000 Euro für Machbarkeitstests.
- 55 % der zuwendungsfähigen Kosten von max. 300.000 Euro für Ausreifung und Marktpilotierung.
- Bei Innovationsnetzwerken werden zuwendungsfähige Kosten von max. 300.000 Euro anteilig und degressiv mit bis zu 90 % erstattet.
Antragstellung:
- Vollelektronischer Teilnahmewettbewerb mit Projektskizze.
- Antragsstellung nur bei laufenden, oft themengebundenen Ausschreibungen (sogenannten “Calls”) möglich. Diese werden regelmäßig im Halbjahresrythmus veröffentlicht.
- Für die gesamte Laufzeit des IGP kann jedes Unternehmen nur eine Förderung je Projektform und Ausschreibung erhalten.
Art der Zuwendung:
- Nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung.
- De-minimis: Ja.
Wer kann gefördert werden?
- Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks mit technologischem Potenzial mit weniger als 100 Mitarbeitenden und höchstens 20 Mio. Euro Umsatz bzw. Bilanzsumme.
Förderschwerpunkt:
- go-Inno zielt auf Produkt- und Verfahrensinnovationen.
- go-digital unterstützt Digitalisierungsprojekte in den Modulen „Digitalisierte Geschäftsprozesse“, „Digitale Markterschließung“ und „IT-Sicherheit“.
Was wird gefördert?
- Beratungsleistungen durch zertifizierte Beraterinnen und Berater.
Maximale Förderhöhe:
- Bis zu 50 % der Aufwendungen (maximaler Beratungstagessatz 1.100 Euro).
- go-Inno: In einem Kalenderjahr kann ein Unternehmen maximal 5 Beratungsgutscheine mit einem maximalen Gesamtwert von 20.000 Euro in Anspruch nehmen.
- go-digital: Der Förderumfang beträgt maximal 30 Tage in einem Zeitraum von einem halben Jahr.
Antragstellung:
- Interessierte Unternehmen können sich mit einem autorisierten Beratungsunternehmen in Verbindung setzen und einen Beratungsvertrag schließen. Den Antrag auf Förderung stellt das autorisierte Beratungsunternehmen.
Art der Zuwendung:
- Unternehmen zahlen nur den Eigenanteil an das Beratungsunternehmen.
- De-minimis: Ja.
Neue Forschungszulage in Deutschland
Wer kann gefördert werden?
- Alle in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen.
Förderschwerpunkt:
- Privatwirtschaftliche Forschung und Entwicklung im Bereich der Grundlagenforschung, der industriellen Forschung und der experimentellen Entwicklung.
Was wird gefördert?
- Eigenbetriebliche Forschung, Auftragsforschung sowie Eigenleistungen eines/einer Einzelunternehmers/in in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (zum Beispiel wenn die Inhabernin/der Inhaber eines Ein-Personen-Betriebs selbst Forschung und Entwicklung betreibt).
- Ein Unternehmen kann sowohl die Forschungszulage als auch FuE-Projektförderung geltend machen solange nicht dieselben Aufwendungen gefördert werden.
Maximale Förderhöhe:
- Eigenbetriebliche Forschung: Der Fördersatz beträgt 25 % der Personalkosten für Forschung und Entwicklung (FuE) und ist auf max. 500.000 Euro pro Unternehmen und Jahr begrenzt.
- Auftragsforschung: Die förderfähigen Aufwendungen liegen für die Auftragsforschung bei 60 % des vom Auftraggebenden an den Auftragnehmenden gezahlten Entgelts und können nur vom Auftraggebenden (und nicht vom Auftragnehmenden) geltend gemacht werden.
- Eigenleistungen: Je nachgewiesener Arbeitsstunde kann der/die Einzelunternehmer/in 40 Euro je Arbeitsstunde bei insgesamt maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähige Aufwendungen ansetzen.
Antragstellung:
- In einem ersten Schritt muss ein Antrag auf FuE-Bescheinigung bei einer (noch zu benennenden) Bescheinigungsstelle gestellt werden. Einzelheiten zum Bescheinigungsverfahren und der Bescheinigungsstelle finden Sie hier. Diese externe Stelle bescheinigt, dass die Aktivitäten des Unternehmens unter die gesetzlichen FuE-Voraussetzungen fallen und deswegen dem Grunde nach ein Anspruch auf Forschungszulage besteht.
- Die Forschungszulage muss im zweiten Schritt beim Finanzamt beantragt werden.
Art der Zuwendung:
- Die festgesetzte Forschungszulage wird bei der nächsten Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer vollständig auf die festgesetzte Steuer angerechnet. Die Leistung erfolgt aus den Einnahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflichtigen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes aus den Einnahmen an Körperschaftsteuer.
- De-minimis: Ja.
Weitere Informationen und Ansprechpartner
Einen Überblick sowie detaillierte Informationen über die Finanzhilfen des Bundes, der Länder und der Europäischen Union finden Sie in der Förderdatenbank des Bundes. Ein wichtiger erster Ansprechpartner ist zudem die Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes. Sie unterstützt Interessenten im Auftrag der Bundesregierung bei der Identifikation geeigneter Förderprogramme auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene in Bezug auf die speziellen Bedarfe, die sich aus einer Projektidee eines Unternehmens ergeben. Wurde bereits ein Förderprogramm ins Auge gefasst, sollte direkter Kontakt mit dem jeweiligen Projektträger aufgenommen werden. Diese Stellen sind mit der fachlichen und administrativen Betreuung der Förderprojekte beauftragt. Sie informieren und beraten Förderinteressenten, nehmen Projektskizzen und Anträge entgegen und begleiten die Durchführung der Projekte bis zu ihrem Abschluss.
- Ob ein Programm das richtige für Sie und Ihr Vorhaben ist, welche Kombinationen und Alternativen Ihnen offenstehen und ob Sie besondere Varianten in Anspruch nehmen können, sollten Sie frühestmöglich in einem persönlichen Gespräch mit der Förderberatung des Bundes oder dem zuständigen Projektträger abklären.
- Bei wiederholten Ausschreibungsrunden kann die Auswertung der zuvor geförderten Projekte und -anträge Hinweise darauf geben, welche Merkmale eines Vorhabens die Chance erhöhen, ausgewählt zu werden. Die Darstellung des Bezugs zu den Förderschwerpunkten des übergeordneten Programms sollte im Antrag berücksichtigt werden.
- Ihr Antrag muss in der Regel vor Beginn Ihres Vorhabens gestellt sein. Eine rückwirkende Mittelvergabe ist normalerweise nicht möglich.
- Achten Sie auf die Aktualität einer Ausschreibung und planen Sie mit den angegebenen Fristen.
- Reichen Sie Ihren Antrag frühzeitig ein. Fördermittel in den Einzelprogrammen sind begrenzt und können schon vor Ablauf eines Haushaltsjahres ausgeschöpft sein.
- Erkundigen Sie sich nach den jeweiligen formalen Anforderungen und dem notwendigen Detaillierungsgrad für Ihren Antrag. Ist ein Auswahlverfahren mehrstufig, kann es sein, dass die detaillierte Ausarbeitung erst in einer nachfolgenden Runde notwendig wird.
- Kommen mehrere Förderprogramme für die Beantragung Ihres Vorhabens in Frage, prüfen Sie vor der Antragsstellung, ob die Mittel kombinierbar sind oder ein Kumulationsverbot greift.
- Beachten Sie die De-minimis-Regel, insbesondere wenn Sie wiederholt Fördermittel beantragen und sich diese kumulieren. Die De-minimis-Regel erlaubt die Unterstützung von Unternehmen mit öffentlichen Mitteln ohne EU-Notifizierung, sofern die Obergrenze von max. 200.000 Euro jährlich nicht überschritten wird. Ausschlaggebend sind dabei das laufende und die beiden vorangegangenen Steuerjahre. Bestimmte Förderungen fallen nicht unter die De-minimis-Regelung.
- Fördermittel müssen nicht nur akquiriert, sondern auch behalten werden. Werden Mittel nicht zweckgebunden gemäß eines Zuwendungsbescheides eingesetzt, besteht ein Widerrufs- bzw. Rückforderungsanspruch des Fördermittelgebers. Zwischen- und Abschlussberichte gehören im vorgegebenen Rahmen der jeweiligen Förderrichtlinie zu den Pflichten der Antragstellenden.